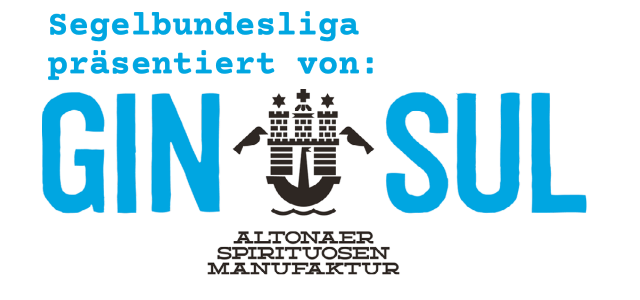Archiv der Kategorie: Panorama
- Olympia
- Porträt
- Videos

TV-Auftritt von Theresa Steinlein: Die IQFoil-Athletin erklärt, wie sie ihr Quali-Wunder schaffte
Die Aufsteigerin
Theresa Steinlein, die 21-jährige Seglerin aus Bayern erklärt im TV-Studio des BR ihren erfolgreichen Umstieg zum Surfen, der sie nach Paris führt. Auch ihre Zwillingsschwester kommt zu Wort. Weiterlesen
- Verschiedenes

SegelReporter Podcast: Über segelnde Reichsbürger, Orcas, America’s Cup, Sieger-Frauen
Flieger, Boote und Yachten
Wie kommt man auf die Idee, Karl Lauterbach in den Kreml zu segeln? Alle 14 Tage sprechen SR-Chefredakteur Carsten Kemmling und Autor und Fahrtensegler Stephan Boden über Themen aus dem Segelsport – Regatten, Cruising, Boote und Leute. Weiterlesen
- Verschiedenes
- Videos

Vermisster Segler gefunden: Acht Tage auf Drift im Mittelmeer
Happy End nach langer Suche
Eine groß angelegte Rettungsaktion für einen Segler, der seinen Törn auf Kreta gestartet hatte, ist erfolgreich verlaufen. Mehr als eine Woche lang war er nicht auffindbar. Warum der Kontakt abgebrochen ist. Weiterlesen
- Verschiedenes

Orca-Angriffe: Erste Aktion 2024 vor Spanien – Wissenschaftler warnen Segler
Es geht wieder los
Vor dem spanischen Malpica bei A Corna hat eine Segelyacht ihr Ruder verloren. Diese Interaktion ist die erste vor der Küste Galiziens in diesem Jahr. Die GTOA mahnt die Segler zur Vorsicht. Weiterlesen
- Porträt

Women Offshore-Projekt: 7 von 120 Frauen ausgewählt – eine spricht deutsch
Immer für eine Überraschung gut
Die ehemalige 49erFX-Seglerin Lisa Farthofer sicherte sich einen Platz in dem ambitionierten Frauen-Hochsee-Projekt UpWind by MerConcept. Ihre Erfahrungen beim Extrem-Rudern im Südpolarmeer haben dabei geholfen. Weiterlesen
- Abenteuer
- Verschiedenes

Hyper-Hurrikan-Saison: Atlantikerwärmung alarmiert Experten – dazu kommt La Niña
Viele Stürme
2024 könnte ein geschichtsträchtiges Hurrikan-Jahr werden. Mehrere Wetter- und Klimaereignisse beunruhigen die Wissenschaftler. Auch europäische Segler sind betroffen. Weiterlesen
- Verschiedenes

Körper gefunden: Einhandsegler ist tot
Traurige Gewissheit
Die Suche nach dem in der Nacht über Bord gegangenen Einhandskipper Philippe Benoiton ist beendet. Der leblose Körper des 63-Jährigen wurde vor Kap Finisterre gefunden. Sein Schiff ist inzwischen abgeschleppt worden. Weiterlesen
- Verschiedenes

Mann über Bord: Einhandskipper wird vermisst – Teilnehmer einer Amateur-Atlantikregatta
Sorge um Segler
Bei der Cap Martinique Regatta sind am Sonntag 60 Boote vor La-Trinité-sur-Mer gestartet, um zweihand und einhand über den Atlantik zu segeln. Ein Skipper wird nun vermisst. Die Suche ist in vollem Gange. Weiterlesen
- Fundstücke
- International
- Videos

Faszination Segeln: Harte Arbeit und jede Menge Spritzwasser
Feuchtes Vergnügen
Beim Segeln kann man schon mal nass werden. Vier Videos zeigen, wie viel Action in diesem Sport stecken kann. Besonders wenn es weht, muss die Arbeit gut koordiniert sein – insbesondere auf einem Power Reach. Weiterlesen
- Verschiedenes
- Videos

Untergang der Arcona 460 “IdaLina”: Die Suche nach der Ursache
"Wir kämpften zwei Stunden lang"
Was für ein trauriges Video. Eine schwedische Crew filmt den Untergang seiner Arcona 460. Es hat offenbar schon früher Geräusche am Ruder gegeben. Die schwedische Werft will das Unglück untersuchen. Weiterlesen
- Fundstücke
- Videos

Zwei Segler gehen bei Crash über Bord
Sail Fail
Eine Webcam im Hafen zeichnet eine skurrile Szene auf. Es kommt zur harten Kollision zweier Sportboote. Zwei Segler sind im Wasser, einer springt von Bord. Erst auf den ersten Blick ist der Grund dafür zu erkennen. Weiterlesen
- Olympia
- Porträt
- Videos

Leonie Meyer im TV: Der unglaubliche Weg der Superwoman – Mit 40 Knoten um die Tonnen
Ein echtes Wunder
Leonie Meyer glückt wohl die größte Leistung aller deutschen Olympiastarter. Während ihrer Metamorphose von der 49erFX-Skiff-Steuerfrau zur Formula Kiterin, schließt sie ein Medizistudium ab und wird Mutter. Weiterlesen
- Verschiedenes
- Videos

Walbesuch nun auch in Kiel
Wenn es nebenan im Wasser bläst
Der vor dem Flensburger Segel-Club gesichtete Buckelwal hat nun auch einen Abstecher zu den Kieler Häfen gemacht. Er wurde am Mittwochmittag in Mönkeberg gesichtet. Weiterlesen
- Verschiedenes

SegelReporter Podcast: Über Lasersegeln, Kielverlust, Seenotfälle und unsere Bootssuche
Wenn der Kiel abfällt
Alle 14 Tage sprechen SR-Chefredakteur Carsten Kemmling und Autor und Fahrtensegler Stephan Boden über Themen aus dem Segelsport, Regatten, Fahrtensegeln, Boote und Leute. Folge 2 Weiterlesen
- Verschiedenes

Olympische Flamme segelt über den Atlantik: Le Cleac’h rast mit Promis über das Meer
Feuer auf Banque Populaire
Wie groß der Stellenwert des Offshore Segelsports in Frankreich ist, zeigt die Planung für den Fackellauf mit der olympischen Flamme. Eine illustre Mannschaft reist per Ultim-Trimaran nach Guadeloupe. Weiterlesen
- Verschiedenes

Mann über Bord: Er hing an seiner Lifeline hinter der Yacht – Wie das passieren konnte
Gerettet?
Ein Segler ist südlich des dänischen Yachthafens Norsminde bei Aarhus über Bord gefallen und hat das Unglück (hoffentlich) überlebt. Er wurde von seiner Yacht durch das Wasser geschleift und erst nach einer Grundberührung gerettet. Weiterlesen
- Verschiedenes
- Videos

Besondere Begegnung: Buckelwal im Hafen vom Flensburger Segel-Club
Bucklige Verwandtschaft
Zum Saisonauftakt sind die Segler bei der Hanseatischen Yachtschule und dem FSC von einem zwölf Meter langen Säugern besucht worden. Er schwammen durch den Hafen von Glücksburg. Weiterlesen
- Bilderstories
- Verschiedenes

First 45 von Beneteau geht unter: Über den Kiel Leck in den Rumpf gerissen
Rasanter Sinkflug
Eine First 45 Beneteau krachte mit dem Kiel gegen einen Felsen und sank innerhalb kürzester Zeit. Nach der Bergung wurde erkennbar, warum die Yacht so schnell auf Tiefe gegangen ist. Weiterlesen
- Fundstücke
- Verschiedenes
- Videos

Fundstück I Am The Walrus: Freya und Wally auf Tour – Ein Walross überlebt nicht
Internet-Star wider Willen
Walrosse, die weit weg von ihrem natürlichen Lebensraum auftauchen, machen zuerst Schlagzeilen, dann Probleme. Eigner machten Druck, weil ihre Boote in Gefahr waren. Weiterlesen
- Abenteuer
- Bootsbau
- Videos

Daten-Sammeln am Südpol: Polar POD – irrwitziges Forschungsprojekt in der Antarktis
Artistisches Kunststück
Während Altersgenossen ihren wohlverdienten Ruhestand genießen, hat ein 77-jähriger Abenteurer ein unglaubliches Unternehmen auf die Beine gestellt Weiterlesen
- Verschiedenes

Mini 6.50-Skipper stürzt ins Meer: Vermisst, von Hubschrauber gesucht
Augenzeuge kann nicht helfen
Eine Gruppe Mini-Eonhand-Segler hat bei einem Training am Samstag vor der Küste von Crozon einen großen Schrecken erlebt. Bei extremen Bedingungen bis zu 8 Beaufort fiel ein Skipper von Bord. Weiterlesen
- Verschiedenes

Schot in der Schraube: Seenotretter befreien Plattbodenschiff aus Gefahr
Rechtzeitig auf den Haken genommen
Im Wattenmeer zwischen den ostfriesischen Inseln Juist und Norderney haben die Seenotretter vier Menschen aus einer gefährlichen Situation befreit. Der Seenotrettungskreuzer EUGEN kam der Besatzung eines Plattbodenschiffes zu Hilfe. Weiterlesen
- Verschiedenes

SegelReporter-Podcast: Es geht wieder los
Neustart
Da ist er wieder – der Segelreporter Podcast. Nach einer Pause mit neuer Besetzung. Alle 14 Tage sprechen SR-Chefredakteur Carsten Kemmling und Autor Stephan Boden über den Segelsport – Regatten, Fahrtensegeln, Boote und Leute. Weiterlesen
- Verschiedenes

Saildrone: Weltgrößte Serien-Segel-Drohne – 65-Fuß-Roboter für die US-Marine
„Gegen maritime Bedrohung“
Nach beeindruckenden Erfolgen für die Wissenschaft, verlagern die kalifornischen Spezialisten bei Saildrone ihr Geschäftsfeld in militärische Anwendungsbereiche. Die Folge: der weltgrößte Segel-Roboter mit 65 Fuß Länge! Weiterlesen
- Verschiedenes
- Videos

Cup-Technik für Segel-Frachter: Mitsubishi-Frachter spart drei Tonnen Treibstoff am Tag
Funktionierende Spritsparhilfe
Der 230 Meter lange Frachter Pyxis Ocean hat seinen den erste 6-monatigen Test mit den WindWings von Ben Ainslies ex Team BAR Technologies erfolgreich bestanden. Wo es noch Probleme gibt. Weiterlesen
- Verschiedenes

Happy End für Soling-Crew: Mitsegler 20 Minuten festgehalten – Was man lernen kann
Cliffhanger
Ein Beitrag aus der Rubrik, was so alles auf dem Wasser passieren kann. Es begann mit einer Patenthalse, dann bricht die Pinne, der Skipper geht über Bord – Lebensgefahr. Seine Retter sind nun geehrt worden. Weiterlesen
- Verschiedenes

Affäre Escoffier: FFV-Sanktionen aufgehoben – offizielle Ermittlungen gehen weiter
Verfahrensfehler
Der französische Sportbund CNOSF gab vor einer Woche in Sachen „Affäre Escoffier“ einen für den Seglerverband FFV ungünstigen Schlichtungsvorschlag ab. Daraufhin reagierte der FFV mit der Aufhebung aller erfolgten Sanktionen gegen Escoffier. Weiterlesen
- Verschiedenes
- Videos

Orca-Angriff: Salzbuckel Kito de Pavant wehrt sich mit Seenotfackel – Ist es die Lösung?
"Eine Botschaft der Natur?"
Kito de Pavant (63) gehört zu den Großen in der französischen Offshore-Szene. Allerdings hat er sich seinen Namen überwiegend durch Dramen auf hoher See erworben. Dieses Muster setzte sich nun bei einer Begegnung mit Orcas fort. Weiterlesen
- Porträt
- Videos

Segeln im NDR-Talk: Boris Herrmann präsentiert sich im TV
Auf der großen Bühne
Nach Susann Beucke war auch Boris Herrmann zu Gast in der NDR-Talkshow. Er zeigt sein Bundesverdienstkreuz und berichtet Hubertus Meyer-Burckhardt und Bettina Tietjen über seine Pläne in diesem Jahr. Weiterlesen